Seit ich denken kann, haben mich Modelle fasziniert. Doch ich wollte nie mit ihnen spielen, überhaupt habe ich wenig "normales" Spielzeug besessen. Ich wollte vielmehr bauen, selbst wenn das Zeit und Aufwand erforderte. Die fertigen Modelle verschwanden meist in Kisten oder Regalen; es ging mir mehr um den Prozess als um das Resultat.
Meine ersten Modelle sollen Autos gewesen sein, auf Papier gemalt und ausgeschnitten, allerdings aus der Vogelschau, was für einen Vierjährigen ungewöhnlich ist und auf einen erstaunlichen (oder bedenklichen?) Sinn für Realismus schließen lässt, womöglich auch nur auf Pedanterie. Jedenfalls hätte ich ein auf der Seite liegendes Auto nicht über den Teppich schieben können. Später habe ich den Dächern und Kühlerhauben die Seiten und Fronten angezeichnet und das Ganze zu dreidimensionalen Gebilden gefaltet, die mit Laschen verklebt wurden. Vorbild dafür waren sicher die Modellbaubogen, die damals eher sporadisch in meiner ländlich geprägten Kinderwelt auftauchten, z.B. als Aufdrucke auf Lebensmittelpackungen. Seit ich das Gymnasium in der Stadt besuchte, konnte ich mir solche Bogen allerdings in besserer Qualität selbst beschaffen. Sie stammten überwiegend von den Firmen Schreiber und Wilhelmshavener Modellbaubogen und waren durchweg sehr kompliziert. Bis heute kann ich mir nicht vorstellen, dass sie für Kinder oder Jugendliche konzipiert waren, aber wahrscheinlich gab es damals noch eine andere Vorstellung vom Zeitmangement und der Geduld junger Menschen. Etwa vier Jahre, zwischen 9 und 13 (also eine sehr lange Phase meiner Kindheit), habe ich mit diesen Bögen verbracht. Ich baute Schiffe und Häuser, vor allem aber Flugzeuge. Jeder Bogen war eine neue Herausforderung. Immer galt es, aus diesem so vollkommen flachen Material etwas Komplexes und Sphärisches zu gestalten. Von heute betrachtet, muss es ein seltsamer, vielleicht sogar beunruhigender Anblick gewesen sein, einen zehn- oder zwölfjährigen Jungen viele Stunden täglich mit solch filigranen Ausschneide- und Klebearbeiten beschäftigt zu sehen. Ich weiß nicht, was meine Eltern damals gedacht haben. Hätten meine eigenen Söhne Jahre lang solche Modelle gebaut, wäre ich vermutlich ein wenig besorgt gewesen.
Tatsächlich fühlte auch ich mich als Papiermodellbauer ein wenig im Abseits lebend. Während meiner Kindheit und Jugend in den 1960er und 70er Jahren erreichten die Plastikmodelle, also die Polystyrol-Bausätze von Firmen wie Revell, Airfix und Heller, gerade den Höhepunkt ihrer Popularität. Die Firmen hatten ein großes Programm und brachten ständig Neuheiten auf den Markt. Als Papiermodellbauer betrachtete ich die Plastikmodelle mit einem gewissen Neid; letzten Endes musste ich ja zugeben, dass die fertigen Modelle realistischer waren als meine aus Papier, zumindest dann, wenn sie sauber bemalt waren. Aber nicht nur der wesentlich höhere Preis verbot ein Umsteigen, ich fühlte lange auch so etwas wie eine Treue zum Papier. Das änderte sich schlagartig, als ich 14 wurde. Ich war gerade dabei, mich von einer schweren Kinderkrankheit zu erholen, da schenkte mir mein Vater, der sich ansonsten so gut wie gar nicht für mein Hobby interessierte, einen Plastikausatz der Victory von Revell.
Das passte mir nun gar nicht ins Konzept. Damals baute ich gerade Kriegsschiffe und Frachter für einen Hafen, den ich auf dem Speicher schon aus Styroporplatten auf dem blau gestrichenem Betonboden angelegt hatte. Dennoch nahm ich das Geschenk, eben weil mein Vater sich ansonsten gar nicht einmischte, als eine Aufforderung. Und dann weckte unversehens die Beschäftigung mit dem Modell (das ich übrigens völlig verhunzte) etwas, das in mir angelegt gewesen sein muss, denn es hat bis heute gehalten: die Begeisterung für alte Segelschiffe! Die zwei Jahre, die mir bis zum völligen Umschwung aller meiner Interessen blieben, habe ich, mit einer ans Manische grenzenden Intensität, Kunststoffmodelle von alten Seglern gebaut. Als Papierbauer musste ich mir dafür ganz neue Techniken beibringen, vor allem den Umgang mit Farben und Takelgarn. Besonders geschätzt, oder besser sage ich: verehrt habe ich die Schiffsmodelle der französischen Firma Heller, die (was ich damals nicht wusste) zumeist Vorbildern aus dem Pariser Marinemuseum nachempfunden waren. Sie gehören zum Besten, was auf diesem Gebiet jemals produziert worden ist. Außerdem beeindruckten sie durch die ebenso seriös wie dramatisch gestalteten Kartons, in denen sie verkauft wurden. Durch sie wurde nicht nur ein (allerdings höchst komplexer) Plastikbausatz angeboten, sondern darüber hinaus das Versprechen der Zeitreise in eine abenteuerliche Epoche.

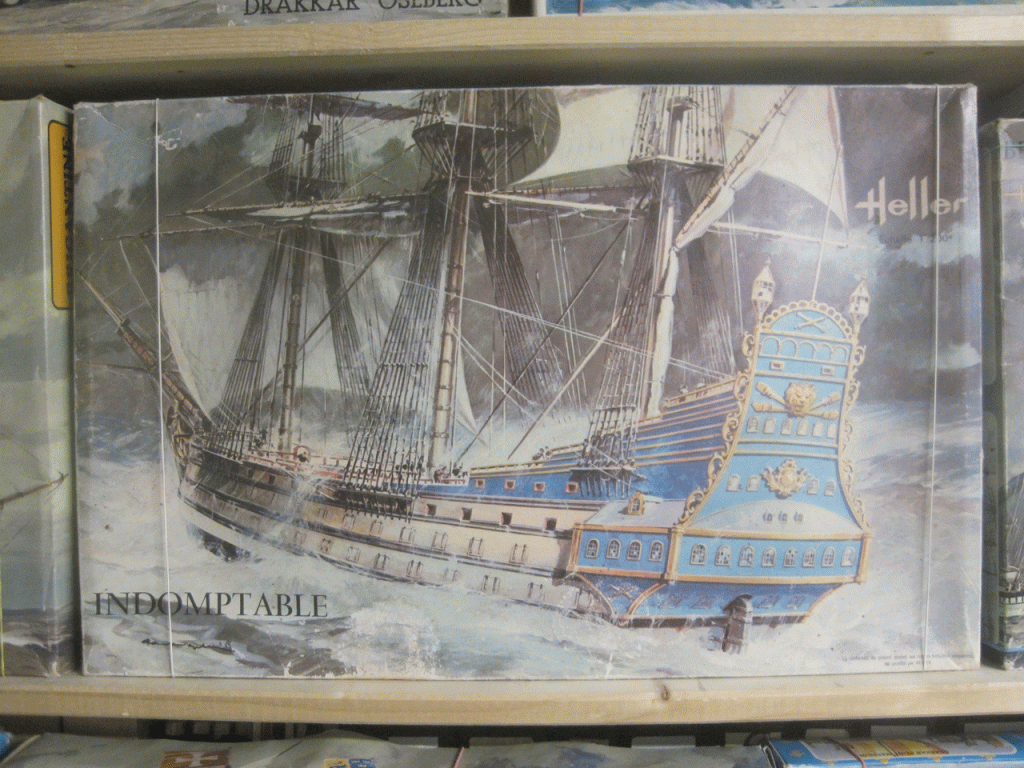
 Leider war mein Zugriff auf diese Modelle sehr begrenzt. Denn seit den späten 60er Jahren erschienen zwar regelmäßig neue Bausätze von Heller-Seglern auf dem Markt, doch nur einzelne Exemplare erreichten die Modellbauläden meiner Heimatstadt, auf deren Sortiment ich angewiesen war. Kaum, dass mich einmal einer der Händler in seinen Katalog sehen ließ! Immerhin erreichte ich, dass meine großstädtischste Verwandte, Großtante Adele aus Amsterdam, bei einem dortigen Modellbauladen (dem weiland „Hoflieferanten“ Merkelbach & Cie. auf der Kalverstraat) die Heller-Modelle bestellte und mir dann per Post zusandte. Das war damals ein bemerkenswerter Akt der Globalisierung.
Leider war mein Zugriff auf diese Modelle sehr begrenzt. Denn seit den späten 60er Jahren erschienen zwar regelmäßig neue Bausätze von Heller-Seglern auf dem Markt, doch nur einzelne Exemplare erreichten die Modellbauläden meiner Heimatstadt, auf deren Sortiment ich angewiesen war. Kaum, dass mich einmal einer der Händler in seinen Katalog sehen ließ! Immerhin erreichte ich, dass meine großstädtischste Verwandte, Großtante Adele aus Amsterdam, bei einem dortigen Modellbauladen (dem weiland „Hoflieferanten“ Merkelbach & Cie. auf der Kalverstraat) die Heller-Modelle bestellte und mir dann per Post zusandte. Das war damals ein bemerkenswerter Akt der Globalisierung.
Bei Nachbarn, die es mir damals abkauften, hat sich eines dieser Modelle bis heute (und in einem erstaunlich guten Zustand) erhalten, die Phenix von Heller, damals sicher die Spitze dessen, was ich im Modellbau erreichen konnte.
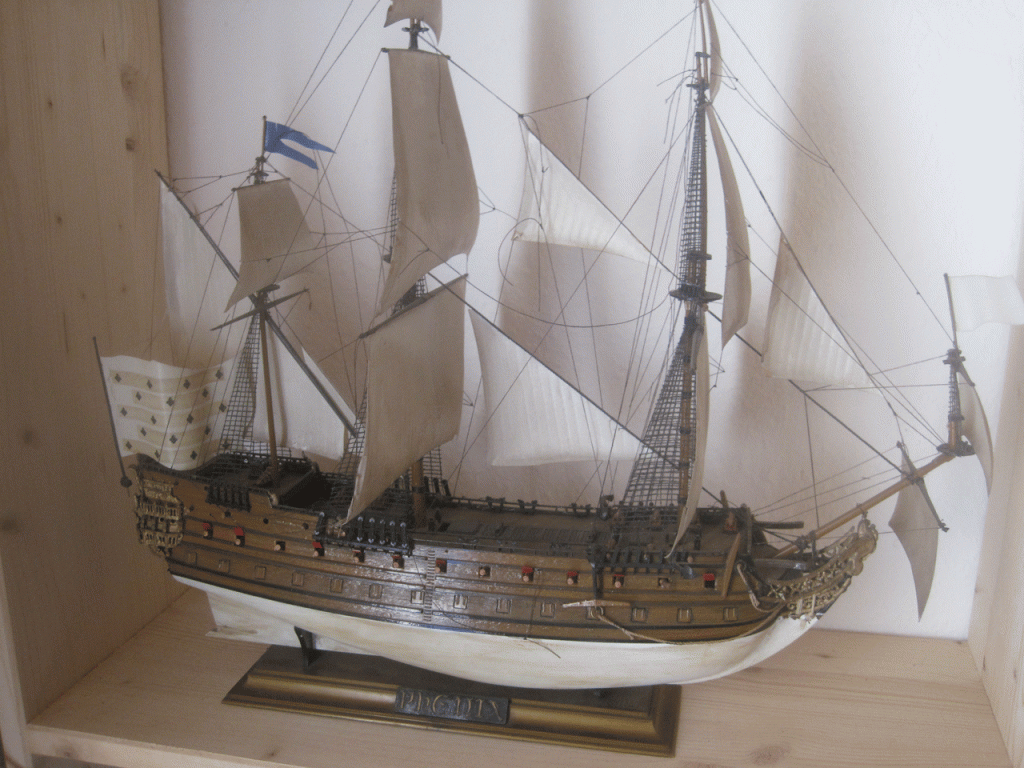
Erhalten ist auch noch das erste Modell, das ich nach der verhunzten Victory baute, die Sovereign of the Seas von der Firma Airfix. Ihr fehlt allerdings mittlerweile die Takelage, an der ich damals fast verzweifelt wäre.
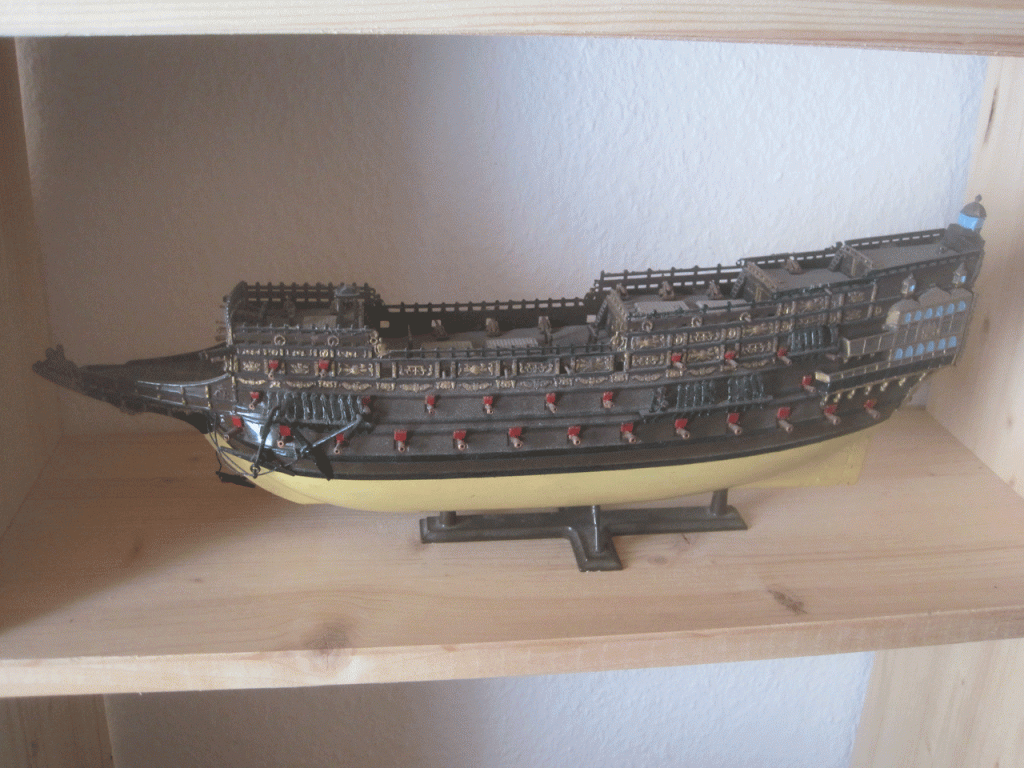
Der Vollständigkeit halber sollte ich erwähnen, dass ich mich gelegentlich auch an Holzmodellen versucht habe, darunter am „Kleinen Uhu“. Das war (und ist) ein Segelflugmodell, das in den 1960er Jahren so etwas wie der VW-Käfer des Modellbaus war und mit dem der Hersteller bundesweite Wettbewerbe veranstaltete. Wenn es um Holz ging, spürte ich allerdings immer besonders deutlich, dass ich fremde Hilfe brauchen würde; und die hatte ich leider nicht. Meine Mutter, von der ich eine gewisse handwerkliche Begabung geerbt habe, nähte uns schneiderte. Und mein Vater besaß zwar einen Meisterbrief als Schlosser, arbeitete aber als Manager und hatte überhaupt kein Interesse an Handarbeiten. Dabei waren die Voraussetzungen für eine leichte Professionalisierung des Modellbaus gar nicht so schlecht: Ich besaß im Haus meiner Eltern mehrere Plätze im Keller und unter dem Dach, die ich als Werkstatt nutzen konnte; ein Luxus, den ich damals schon als solchen empfand.
Doch es ist nicht larmoyant und hat (hoffentlich!) nichts mit dem verbreiteten Bedürfnis zu tun, zur universellen Entschuldigung der Gegenwart die eigene Kindheit schlechtzureden, wenn ich sage, dass mir während dieser ersten Phase meines Modellbaus praktisch alles missglückt ist. Tatsächlich war ich nie – nie! – mit dem Erreichten vollkommen zufrieden; und das jeweils nächste Modell baute ich weniger, um die Freude zu verlängern, als vielmehr, um den Frust über das letzte Scheitern vergessen zu machen.
Warum ich immerzu scheiterte? Die Antwort ist einfach und trivial. Ich besaß nicht die richtigen Werkzeuge, es fehlten mir Kenntnisse über den Umgang mit Materialien und Farben, und ich hatte neben den Bauanleitungen praktisch keine Hilfe. Einen Austausch etwa unter Schulkameraden gab es nicht, zumal wir alle in weit voneinander entfernten Stadtteilen wohnten. Ich selbst machte damals allerdings meine Ungeduld für alles verantwortlich. Und ganz falsch lag ich damit nicht. In meiner Familie hieß es zwar, ich müsse ein Ausbund an Geduld sein; wie sonst könne man all die Kleinteile eines Modellbogens ausschneiden und falten oder die Takelage eines Dreimasters zusammenknüpfen? Ich nahm das Lob auch gerne entgegen. Aber ich wusste leider zu gut, dass ich die Hälfte der Taue und ein Gutteil der Kleinteile einfach weggelassen hatte, um schneller zum Ende zu kommen. Ich nahm mir auch nicht die Zeit, meine bescheidenen Werkzeuge zu pflegen. Meine Pinzetten waren immer verbogen, die Scheren stumpf, und die Pinsel standen mit ihren Haaren im Farbschlamm am Boden eines Glases mit schwarzem Terpentin. Als mit dem ersten Tanzkurs im Herbst 1972 mein Interesse am Modellbau schlagartig aussetzte, war ich eigentlich ganz froh. Immerhin war damit eine Quelle der Frustration versiegt. (Freilich nur, um eine neue sprudeln zu lassen; doch das ist eine andere Geschichte.)
Erst während meiner Studienzeit meldete sich der Antrieb zum Modellbau wieder. Doch nun fehlte mir vor allem der Platz, ihn weiter zu betreiben. In meinem Studentenzimmer hätte ich den Schreibtisch freiräumen müssen, eine nicht zu leistende Arbeit angesichts der Papierstapel darauf. Trotzdem gab es sporadische Ausflüge in die Bastelwelt. Eine Freundin hatte eine große Wohnung, in der mir eine Bastelecke eingerichtet wurde. Außerdem verfügte sie über einen Kellerraum, in dem ich meine Modelle (damals waren es Autos aus den 50er und 60er Jahren im Maßstab 1:24) spritzlackieren konnte. Als wir uns trennten, musste ich die Automodelle allerdings aufgeben. Durch eine Reihe von Zufällen haben sie sich alle erhalten. Seit vielen Jahren stehen sie gedrängt und still einem ehemaligen Manuskriptschrank.

Zusammen mit einer anderen Freundin, zu der die Beziehung sich von Anfang an problematisch gestaltete, baute ich die Burg Hohenzollern (ca. 60 x 40 cm) aus Schreibers Modellbaubogen. Wir saßen dazu wie die Kinder auf dem Fußboden in meinem Studentenzimmer, schnitten aus, falteten, reichten uns den Leim und beugten uns gemeinsam über die Bauanleitung. Es dauerte etliche Abende, an denen (genau wie ich es erhofft hatte) mehr Ruhe und Einvernehmen zwischen uns herrschte als sonst. Als auch diese Beziehung zerbrach, habe ich die Burg angezündet.

Nach meiner Heirat 1985 und dem Umzug in eine kleine Wohnung hatte ich dann endlich wieder ein bisschen Platz für den Modellbau, wenngleich es nur der Platz am Küchentisch war. Doch es wiederholte sich ziemlich genau, was fünfzehn Jahre zuvor die Regel gewesen war: Meine Wünsche und Vorstellungen, mittlerweile durch die Anschauung anderer Modell (zum Beispiel bei Messebesuchen) vergrößert und verfeinert, eilten immer noch meinen Fähigkeiten voraus. Einen unfertigen Schiffsrumpf aus dieser Phase habe ich unlängst erst wieder über einen Umzug gerettet: gewissermaßen als Mahnmal an eine Zeit der permanenten „kognitiven Dissonanz“, sprich des leidvollen Unterschieds zwischen Wunsch und Wirklichkeit.
Die Wende kam erst in den späten 1990er Jahren. Durch eine Reihe von Zufällen war ich zur Modelleisenbahn gekommen (beschrieben in meinem Buch "Kleine Philosophie der Passionen. Modelleisenbahn", 1997, leider vergriffen). Ich hatte angefangen, Ha-Null-Lokomotiven aus der Serienproduktion von großen Firmen wie Fleischmann oder Trix zu überarbeiten. Später baute ich Lokomotiven aus Bausätzen, die Materialien waren vor allem Messing und Metallguss. Und nun, welch ein Wunder!, gelang mir etwas. Ich war genau vierzig Jahre alt, als ich zum ersten Mal ein Modell in der Hand hielt, das ich selbst gebaut hatte und das mir rundherum gelungen zu sein schien. Ich werde das nie vergessen: Es war (und ist) eine kleine preußische Tenderlokomotive vom Typ T4, gebaut aus einem Bausatz der längst aufgelösten Firma Merker + Fischer. Ich hatte sie zusammengeklebt und -gelötet, mit der Airbrush lackiert und schließlich mit feinen Zierlinien aus Abziehbildern dekoriert. Übrigens fuhr sie auch, so gut der primitive kleine Motor das zuließ, und ihr Gestänge bewegte sich störungsfrei.

Sieben Jahre lang habe ich mit großer Begeisterung solche Lokomotiven gebaut und umgebaut. Die Sammlung wird auch weiter gepflegt, wenngleich nicht mehr nennenswert ausgebaut.

Was war passiert? Natürlich kein Wunder. Ich war mit meiner Modellbauerei bloß im Informationszeitalter angekommen. Die Anregungen dafür, wie man etwas baut, das einem auch gefällt, holte ich mir jetzt aus Fachzeitschriften und zunehmend aus dem Internet. Ende der 1990er Jahre war die Zeit angebrochen, in der niemand irgendeine Alltagsverrichtung „nicht können“ oder irgendein Produkt „nicht kennen“ konnte. Denn jetzt gab das Netz umgehend Antwort auf alle Fragen. Möglich, dass es mittlerweile weniger Modellbauer gab als in den beschaulichen 1960er Jahren, aber die wenigen waren nicht weniger versiert, und darüber hinaus präsentierten sie ihre Arbeiten im Netz. Foren für praktisch jede Form von Modellbau sind seitdem eingerichtet, in denen man Antworten auf jede noch so spezielle Frage findet. Und nicht nur das. Mit den Antworten kommt meistens gleich ein Link zur Online-Bezugsquelle. Damit war mein Problem gelöst. Ungeschickt war ich nie gewesen, es hatte mir nur an Know-how gefehlt. Jetzt quoll das Netz davon über; und prompt versank ich in eine zweite Jugend, in der mir (wohlgemerkt: im Modellbau!) all das gelang, was in der ersten gescheitert war.
Seit über 20 Jahren betreibe ich jetzt wieder Modellbau, anfangs eher systematisch mit dem Ziel des Aufbaus von durchstrukturierten Sammlungen (z.B. alle preußischen Dampfloks von T 1 bis S 10!), seit einiger Zeit aber wieder etwas chaotischer, oder sagen wir: spontaner. Ich lasse ich mich gerne von neuen Materialien und Techniken wie Ölfarben oder dem Resinguss dazu bewegen, beim nächsten Modell etwas ganz anderes zu versuchen. Hier das Modell der Statenjacht Utrecht, gebaut aus einem Resinbausatz der holländischen Firma Artitec und mit einer Acryl-Öl-Mischtechnik bemalt.

Dass ich seit über zehn Jahren wieder Schiffe baue, hängt einerseits damit zusammen, dass beim Schiffsmodellbau eine besonders große Vielfalt von Techniken und Materialien herrscht. Andererseits, ich sagte es ja schon, interessieren mich Schiffe nun einmal sehr, vielleicht, weil jedes Schiff ein Individuum ist und jedes eine Geschichte mitbringt. Eine etwas esoterisch veranlagte Freundin von mir vermutet, mein Ich sei vor 200 Jahren zu See gefahren und erinnere sich jetzt an diese, womöglich besonders glückliche, Inkarnation. Wer weiß! Gebaut habe ich in den letzten Jahren Schiffe vom mittelalterlichen Einmaster bis zum Kanonenboot des 19. Jahrhunderts. Daneben sammele ich die alten Plastikmodellbausätze, die es damals beim "Puppenkönig", dem größten Spielwarengeschäft in meiner Heimatstadt, nicht gab.

Obwohl mir nun in den letzten Jahren einiges zu meiner Zufriedenheit gelungen ist, hatte ich (wie wohl jeder Modellbauer) weiter von einem Meisterstück geträumt. Von dem Modell, das alles Bisherige in den Schatten stellen würde. Und mit Hinblick auf mein Lebensalter hatte ich mich gelegentlich schon gefragt, was genau es denn werden soll – und vor allem wann? Ein nach selbst recherchierten Unterlagen gebautes Modell des ersten kaiserlichen Panzerschiffs aus den 1870er Jahren? Die monumentale „Royal William“, ein barocker Dreidecker aus einem legendären italienischen Bausatz? Oder was sonst?
Doch da spielte mir ein Zufall mein Chef d’Oeuvre, die Krönung meiner Modellbauerlaufbahn, gewissermaßen vorzeitig in die Hand. Und genau davon möchte ich hier berichten.